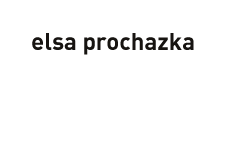
| Elsa Prochazkas diskrete Architektur
Die Verschiedenheit, wie man gelernt hat die Welt zu sehen, würde männliche und weibliche Architektur prägen. Elsa Prochazka erläutert im KONSTRUKTIV-Interview ihre unterschiedlichen Sichtweisen zu der von Männern dominierten Planungswelt. Die renommierte Vertreterin der heimischen Architekturszene sieht in den nächsten Jahren eine starke Architektinnen-Generation heranwachsen. Das Gespräch mit Prochazka führte Gerfried Sperl. Sperl: Sie besitzen einen wilden Garten. Aber man merkt trotzdem die Zähmung. Und es gibt ganz sparsame architektonische Eingriffe. Eine Stiege mit Geländer. Eine Leuchte. Hat das etwas mit Ihrer Architekturauffassung zu tun? Prochazka: Das ist eine witzige Beobachtung. Mir ist es zuwider, alles bis in die letzte Ecke zu kontrollieren. Gleichwohl muß der Gesamteindruck zum Ausdruck bringen, dass es sorgfältig gewählte Interventionen gab. Sperl: Damit stehen Sie ein bißchen außerhalb des Mainstream in der österreichischen Architektur. Die großen Protagonisten neigen zum Gesamtkunstwerk. Bis ins Detail. Prochazka: Obwohl mir das Detail sehr, sehr wichtig ist, bekenne ich mich nicht zu einer solchen Haltung. Die Intention zeigt sich auch durch den pointierten Einsatz von Details - wenn man will. Der Ganzheitsanspruch ist etwas Bürgerliches. Diese Art von Weltkonstrukt ist gescheitert. Sperl: Wie würden Sie Architektur überhaupt definieren? Geht das in einem Satz? Prochazka: Für mich ist das eine Herausforderung, Architektur jeden Tag neu zu definieren. Das Spannende am Architekturbegriff ist, daß er einem immer wieder entgleitet. Sperl: Warum gibt es so wenige Architektinnen? Es studieren ja ziemlich viele Frauen. Prochazka: Das ist erst in den letzten Jahren so. Gleichviel Frauen wie Männer in den Architekturbüros, das gibt es erst seit ein paar Jahren. Jetzt kommt auf uns eine starke Architektinnen-Generation zu. Ich war seinerzeit noch die einzige Studentin in der Meisterklasse Plischke. Ich habe in Wien in den Jahren 1966 bis 1973 studiert. Sperl: Haben Frauen eigentlich eine andere Vorstellung von Architektur als Männer? Prochazka: Das kann man schwer beantworten, weil es wie gesagt wenig Architektur von Frauen gibt. Aber sie müssen verschiedene Fragen natürlich anders beantworten: Die Verschiedenheiten des Geschlechts fallen weniger ins Gewicht als die Unterschiede, wie man gelernt hat, die Welt zu sehen. Sperl: Sie haben eine Frauen-Werk-Stadt geplant. Das war doch eine Art Gegenentwurf. Prochazka: Ein Gegenentwurf war nicht beabsichtigt, es war kein ideologisch überfrachtetes Projekt. Es hat aber intensive Diskussionen gegeben - sowohl mit den Politikern, den Auftraggebern, den Bauträgern als auch mit den Ausführenden und Nutzern. Alle Positionen waren fast ausschließlich durch Frauen repräsentiert, was für die meisten völlig ungewohnt war. Sperl: Was ist im einzelnen neu? Prochazka: Marginale Schritte. Zum Beispiel Tageslicht für die sonst ganz finsteren Tiefgaragen. Oder transparente Aufzüge. Oder, daß Heizen, Waschen und Spielen aus den Kellern herausgeholt und in den Bereich der Dächer verlegt wurden. Das ist eine neue Qualität für geförderten Wohnbau. Sperl: Wie sieht es dabei mit der Anordnung der Räume in den Wohnungen aus? Prochazka: Gleichwertige Räume anzubieten war Ausgangsbasis, mit verschiedenen Optionen Räume abzutrennen oder zusammenzulegen. Denn das Familienprofil ändert sich ja nach den Lebensphasen. Also soll es nichts hierarchisch Organisiertes geben. Manche kommen aber schon mit sehr festgefahrenen Vorstellungen zur Wohnungssuche. Diese Vorstellungen etwas in Bewegung zu bringen ist mit diesem Projekt gelungen. Sperl: Sie haben die Tiefgaragen erwähnt. Was haben Sie an der Wiener Stadtplanung zu bemängeln? Denn die hat jahrelang nicht gerade wirtliche öffentliche "Tiefgaragen" produziert. Beispielsweise die Jonas-Grotten. Prochazka: Es gibt sehr viele, sehr gute Ansätze und Projekte. Schwierig ist die Umsetzung. Das dauert alles viel zu lange. Sperl: Anders gefragt: Sollte man nicht aus dem derzeitigen Parlament ein Museum machen und ein neues bauen. Eines, das dem heutigen Demokratie-Gefühl entspricht? Prochazka: Gesellschaftliche Wirklichkeit ist nie 1:1 in Architektur umsetzbar. Einerseits kann Architektur inhaltlich immer wieder neu belegt werden. Andererseits hat sie einen viel längeren Zyklus als gesellschaftliche Veränderungen. Architektur muß also mehr aushalten als nur das, was gerade geschieht. Architektur muß einen längeren Atem haben. Sperl: Das heißt, daß ein Parlament lange dienen kann. Prochazka: Man muß nicht gleich Parlament und Rathaus durch etwas anderes ersetzen. Aber ich bin schon erstaunt, wie sich Entscheidungsträger oft ihr eigenes Umfeld gestalten. Wenn man sich den Innenhof des Rathauses anschaut: wie die Leistungsschau verschiedener Gartencenter. Oder die Büros der Politiker. Sehen die sich selbst so? Was auch mit der Einstellung der Österreicher zusammenhängt, daß ein Politiker sichtbar kein Geld ausgeben darf. Er muß so tun, als wäre das alles gleichgültig. Das ist eine Art selbstverordneter falscher Bescheidenheit, die sich auf den Umgang mit öffentlichen Gebäuden überträgt, die zwar nie billig, aber meist völlig uninspiriert sind. Sperl: Sie haben in der Architektur eine eigene Nische besetzt. Sie sind eine Gedenk-Architektin der wichtigsten Komponisten geworden. Prochazka: Ich würde eher sagen, ich habe einen „Erker“ besetzt. Immerhin lehnen sich die Österreicher mit ihren Ikonen gern aus dem Fenster. Anlass für diese Aufgabe war, dass der Anspruch der Besucher an derartige Einrichtungen in den letzten Jahren enorm gewachsen ist. Daher wollte man eine neue Sicht auf diese speziellen Orte eröffnen. Sperl: Was ist der Grundzugang? Man könnte ja auch eine CD-Rom machen? Prochazka: Erstens der Reiz, die österreichischen Klischees anzukratzen - Mozart - Haydn - Schubert - Beethoven, Strauss - dazu hat fast jeder eigene Bilder im Kopf. Meine Architektur hat ja auch entsprechende Kontroversen ausgelöst. Zweitens jener fetischistische Aspekt, der durch Virtualität nicht ersetzbar ist. Sperl: Frau Prochazka, was würden Sie am liebsten bauen? Prochazka: Mein Architektur-Interesse liegt sicher in großen öffentlichen Bauten. Es geht dabei um den Maßstabssprung und die Möglichkeit Kraft und Grosszügigkeit wirksam werden zu lassen. Zum Beispiel ein Konzerthaus oder Theater. Durchaus aber auch Hybridbauten, in denen sich neue Lebensformen ausdrücken. Zum Beispiel die Kombination von Kino und Bahnhof. Sperl: Was würden Sie aus dem Westbahnhof machen? Prochazka: Das wäre ein Traumauftrag. Ich würde ein Gebäude hinstellen, das den Namen "Europaplatz" auch wirklich verdient. Dazu kommt diese Verknüpfung eines innerstädtischen Bahnhofs mit der Mariahilferstrasse. Dort liegt eine der schönsten städtebaulichen Sichtachsen. Sperl: Einige kurze Fragen noch. Ist eigentlich die Romanik für Sie ein bevorzugter Baustil? Prochazka: Ich weiss zwar nicht, wie Sie jetzt auf diese Frage kommen. Die Klarheit und Erdverbundenheit der Baumassen bringt eine Idee zum Ausdruck, die ich nachvollziehen kann, aber die wir schon ziemlich weit hinter und gelassen haben. Sperl: Wie wichtig ist Ihnen das Licht? Prochazka: Das ist unglaublich wichtig. Die Schwerfälligkeit der Architektur aufgrund der Materialität wurde durch neue technische Möglichkeiten, Licht einzusetzen, kompensiert.. Meine Installation bei der Architektur Biennale in Venedig arbeitet mit diesem Phänomen. Sperl: Welchen Architekten oder Baumeister früherer Zeit hätten Sie gerne persönlich gekannt? Prochazka: Josef Frank, weil er Humor hatte. Sperl: Schriftsteller? Prochazka: Gertrude Stein, weil ihre Sätze wie Architektur sind.
|