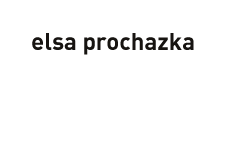Ein Leben im Schatten von Mayerling
Ausstellung, Wien 1989
Mehr als die Dokumente vom spektakulären Doppelselbstmord des Kronprinzen in Mayerling, lassen die Zeugnisse seines Lebensweges, der von extremen Widersprüchen geprägt ist, für den Besucher ein Verständnis für den "Mythos" entstehen.
Politische, familiär-private und individuelle Charakteristika seiner Person und aus seiner Zeit erlauben durch die Art der Präsentation das Nachempfinden einer Biographie, von der sonst nur das Ende im Blickpunkt von Interesse und Spekulation steht.
Die Verknüpfung von authentischem Ort - der Hermesvilla als temporärem Wohnsitz der kaiserlichen Familie - und der zeitgenössischen Sicht auf eine Biographie, lassen durch die Installationen aus Eisen in einer historistischen Raumabfolge ein neues Bild der Person entstehen.
Elsa Prochazka - Architektin
Zwei Denkweisen des Designs sind in Elsas Prochazkas Arbeit miteinander verwoben. Die eine fusst auf den unpathetischen, liberalen Ansichten der Wiener Moderne der zwanziger Jahre, auf dem Ideengut von Josef Frank, vermittelt und präzisiert nicht zuletzt durch Prochazkas Lehrer Ernst A. Plischke; die andere folgt dem kritischen Realismus der internationalen Kunstszene am Beginn der siebziger Jahre. Die eine sucht in deutlicher Distanz zu Bauhaus und DeStijl die Entmonumentalisierung der Gegenstände, die Befreiung vom historischen wie vom modernistischen Stilbegriff; die andere entdeckte die ästhetische Kraft des Banalen, das bildnerische Potential der Trivialkultur. Die eine strebte nach einer Modernität, welche Eleganz und Behaglichkeit, Emotionalität und Schlichtheit, Subjekt und Objekt im Gleichgewicht hält; die andere verwarf den moralisierenden Anspruch der Avantgarden und diagnostizierte am geschmacklosen Alltag der einzig authentischen Regelkreise der medialen Massenkultur.
"Schöne Monotonie" hiess 1973 ein Text von Eberhard Kneissl und Elsa Prochazka, ein illusionsloses, widerborstiges Statement am Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit. "Bastard Architektur" war 1975 eine noch schärfere Apologie für den pfiffigen, im Ernstfall auch "kitschigen" Umgang mit dem Gewöhnlichen, für Designstrategien, die der verschwenderischen, totalitären Rationalität des Ingenieurs die improvisierende, ökonomische "arte povera" des Bastlers entgegensetzen. "Gezinkte Alltäglichkeit" wäre ein anderer Begriff, der ihre (mit Werner Appelt) bis in die Mitte der achtziger Jahre dann konzipierten Bauten charakterisieren könnte.
Von Elsa Prochazka hier dokumentierten, neueren Projekten, zeigt die Ausstellung "Kronprinz Rudolf" den interessantesten Ansatz. Historische Ausstellungen verführten zuletzt und gerade in Wien die Architekten zu problematischen Überinszenierungen. Das Bild der Geschichte verschwand hinter dem eitlen Pomp architektonischer Bühnenbilder. Wie in der Hermesvilla dagegen einer der populärsten Mythen aus dem Kitscharsenal der österreichischen Identität wissenschaftlich und gestalterisch gegen den Strich gebürstet wurde, das macht diese Präsentation zum Massstab für alle künftigen Unternehmen dieses Genres. Das komplexe, durch Sentimentalität und Legendenbildung verdeckte Schicksal des Thronfolgers inhaltlich und formal transparent zu machen, war die Herausforderung, und ist die Leistung dieser Ausstellung. Prochazka hat die Stationen der Biographie analog zu den ursprünglichen Raumfunktionen der kaiserlichen Villa gegliedert und den Gegensatz von öffentlichem und privatem Leben Rudolfs durch die Verteilung auf parallel gelegene Räume betont. So ist etwa der Festsaal gleissend ausgeleuchtet zu "glatten Parkett der Öffentlichkeit" deklariert. Aus Lautsprechern, die in einer Reihe Zierpalmen versteckt sind, vernimmt der Besucher ein "Ballgeflüster", eine Montage kontroversieller Zitate von Zeitgenossen über den Kronprinzen, durchmischt mit seinen eigenen Aussagen. In Elisabeths Salon werden seine Beziehungen zu Frauen dokumentiert, in Franz Josephs Räumen "das männliche Prinzip" - Militär, Politik usw.
Allzu glatte Einschreibung ins Ambiente verhindert aber die Fassung der Exponate durch Vitrinen, Stehpulte und Podeste aus rohen Eisenprofilen. Sehr einfach, doch subtil verarbeitet, bilden sie einen denkbar harten Kontrast zwischen dem historischen Umraum und den originalen Dokumenten und schneiden mit chirurgischer Schärfe das Thema aus seiner schwammigen Aura von Dekadenz und Skandal heraus: Autographen liegen unter Glas auf lakonischen Streckmetallgittern; alte Kleinbildfotos, bewusst nicht vergrössert, sind in Serien hinter massiv, eiserne Passepartout-Platten eingepasst; verschieden Objekte sind durch gebogene, gekantet Blechsockel vom Boden abgehoben.
Auf den ersten Blick erinnert dieses Metalldesign an frühe Installationen von Franco Albini oder Carlo Scarpa. Eiserne Staffeleien, Stehlen oder Rahmen sind hier aber weniger prätentiös und kommentierend detailliert als bei Scarpa. Elsa Prochazkas Ausstellungsgeräte sind aus antiauratischen Materialien geformt, mit konstruktivem, da und dort auch formalen "Witz" gefügt. Sie entschlacken optisch das Präsentierte vom falschen Glamour, sie sind insgesamt ein Sinnbild für die eherne höfische Konvention, an der Rudolfs Ambitionen zerschellten, sie legen den Blick auf Originale frei und verdeutlichen zugleich die dennoch unüberwindliche Distanz zwischen Heute und Damals, zwischen dem Dokument und dem, was es dokumentiert - und sie sind nicht zuletzt durchwegs zweckmässig und massstabbildend.
Ein Höhepunkt ist zweifellos der "Mayerling-Raum", ein mit kaltem Neonlicht gründlich ausgeleuchtetes Zimmer, darin zwei Vitrinen nebeneinander "aufgebahrt", mit den ganz wenigen wirklichen Dokumenten über das Ende Rudolfs mit Mary Vetsera bestückt: Ein Raum, der die Atmosphäre der Prosektur andeutet, die Grausamkeit der Staatsräson, den Zynismus, des Begräbniszeremoniells und er Vertuschungsaktionen rund um diese Tragödie.
Inszenierung von Geschichte, die jegliche Form von Ausstellung doch ist, kann so oder so sein. In diesem Fall ist es gelungen, aus einem extrem belasteten Sujet die Figur eines paradigmatischen, modernen Schicksals herauszuarbeiten und in eine erfrischende, zeitgenössische Installation umzusetzen.
Mit möglichst geringen Eingriffen die gewünschten Effekte zu erzielen, den gestalterischen Aufwand auf wenige, wichtige Punkte zu konzentrieren, dazwischen manches auch "locker" zu lassen - dies Haltung prägt auch die Entwürfe für den Dominikanerkonvent und das neue Bodenseeschiff der ÖBB. Licht ist das einfachste, subtilste Mittel, um einen Raum zu "möblieren", gefolgt von Farbe und Farbstimmung. Im Festsaal der Dominikaner bringt ein einziges Element - die Wandleuchten - eine räumliche und atmosphärische Palette verschiedenster Stimmungen zustande. In der Mischung von Seidenschirmen und Halogenspots schimmert auch hier die Collageästhetik des Trivialen durch.
Gewöhnliches - mit Gewöhnlichem gezielt kombiniert - kann plötzlich ein aussergewöhnliches, unverwechselbares Resultat erzeugen. Es genügt beispielsweise, einem banalen, hölzernen Stapelstuhl einen Sitz aus farbig abgestimmtem Linoleum zu geben, um die Banalform zu "beschleunigen", frisch zu machen, zum Flimmern zu bringen. Es genügt eine kleine Korrektur in der Silhouette, ein veränderter Schwung im Übergang vom Vorschiff zum Hauptdeck, um einem vorgegebenen Werksentwurf seine pragmatische Biederkeit auszutreiben ...
Es ist dies aber eben nicht mehr Mies’ "less is more" oder Plischkes Wegschleifen aller Details bis zum Nullpunkt, das eine solche, im gegenwärtigen, hysterischen Umfeld fast abseitige Designhaltung ausmacht. Aber doch eine ähnlich gelassene, konkrete, reife Auffassung von Architektur._
Otto Kapfinger
in: Möbel Raum Design, 12. Jahrgang Nr. 1/90